Die Feststellung, daß nun in unserer Gottscheer Geschichtsschreibung das 20. Jahrhundert beginnt, ist eigentlich nur eine kalendarische Pflichtübung, kerne Zeitenwende, kein tiefer Einschnitt, die beiden Jahrhunderte liefen in Gottschee ebenfalls glatt ineinander über. Die gravierenden Veränderungen waren bereits im 19 Jahrhundert geschehen. Die ungehemmte Auswanderung lief weiter - immer weniger Amerika-Fahrer kehrten zurück. Die Zahl der Hausierer nimmt ab. Ihre Wandergewerbescheine sind doppelsprachig geworden, Deutsch steht noch an erster Stelle.
Die Stadt Gottschee wächst und modernisiert sich weiter. In allen ihren Lebensbereichen ist die energisch führende Hand des Bürgermeisters Alois Loy zu spüren. Er lebte von 1860 bis 1923. Er war einer der bedeutendsten Persönlichkeiten, die das Gottscheerland hervorgebracht hat. Seine ungewöhnliche Begabung für die Kommunalpolitik und seine Überlegenheit als Mensch und Charakter wurden frühzeitig erkannt. Bereits mit 21 Jahren gehörte er dem leitenden Ausschuß der Stadtsparkasse an und mit 29 Jahren wurde er zum Bürgermeister gewählt. 33 Jahre blieb er, von keiner Seite angefochten, erst nach 1918 von der neuen Staatsgewalt aus dem Amt vertrieben, seiner Stadt treu. Die Gottscheer Zeitung vom September 1962 widmete ihm ein Gedenkblatt folgenden Inhalts: "Unter ihm wurde aus dem dorf- und marktähnlichen Ort ein schmuckes Städtchen. Überall hatte er seine ordnende und betriebsame Hand im Spiele. Daß beim Bau der Unterkrainer Bahn die Interessen Gottschees ausreichend Berücksichtigung fanden, war mit sein Verdienst. Unter seiner tatkräftigen Initiative entstand der imponierende Bau der Volksschule, wurden das städtische Wasser- und Elektrizitätswerk und die untere Brücke errichtet.

Alois Loy, letzter deutscher Bürgermeister der Stadt Gottschee
Ein besonderes Verdienst Loys ist der Ausbau des Gymnasialgebäudes. Er verstand es auch durchzusetzen, daß die Anstalt ein Obergymnasium erhielt und daß die Holzfachschule vom Staat übernommen wurde. Der Verein Studentenheim kam durch ihn zu Haus und Besitz. Als Obmann des Kirchenbauausschusses verstand er es tatkraftig, den Bau der Stadtpfarrkirche - noch heute eine Zierde der Stadt - voranzutreiben. Für seine Verdienste erhielt Loy das "Goldene Verdienstkreuz mit der Krone und den Titel eines kaiserlichen Rates." - Die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit befruchtete das ganze "Ländchen".
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchten in der Stadt Gottschee zum erstenmal Presse-Erzeugnisse auf: Die "Gottscheer Nachrichten", der "Gottscheer Bote" und Der Landwirt". Alle drei Blätter erschienen 14tägig und wurden in der eben gegründeten Druckerei des J. Pavlicek gedruckt. Sie wendeten sich in erster Linie an die Bauern. 1905 entstand der "Gottscheer Bauernbund". Eine lebhafte Diskussion über Fragen der österreichisch-ungarischen Monarchie und die eigenen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Belange beschäftigte die Gemüter. Die Abonnentenzahlen von Grazer und Wiener Zeitungen stiegen im Gottscheerland.
1907 dürfen die Gottscheer - zum erstenmal als eigener Wahlkreis organisiert - einen Abgeordneten zum Wiener "Reichsrat" wählen. Zwei Parteien stellen ihren Kandidaten auf, die "Liberalen" - von ihren politischen Gegnern als "die Roten" bezeichnet - und die "Christlich-Sozialen", von der Gegenseite als "die Schwarzen" abgestempelt. Der Kandidat der Liberalen heißt Fürst Karl von Auersperg, Herzog von Gottschee (1859 bis 1927).
 |
 |
| Fürst
Karl von Auersperg, Herzog von Gottschee (1859-1927). |
Josef
Obergföll Schulrat, Gymnasiallehrer in Gottschee |
Sein Gegenkandidat: Schulrat Josef Obergföll, Gymnasiallehrer in Gottschee. Der Wahlkampf wurde mit einer bis dahin unbekannten Heftigkeit geführt und artete vielfach zu Schlägereien aus. Einer der eifrigsten Wahlredner war der Student Peter Jonke aus Obermösel, ein Liberaler.
Der Fürst gewann die Wahl. Er konnte kraft seiner vielseitigen Beziehungen in Wien, die bis ins Kaiserhaus und in die Ministerien reichten, für die Bewohner seines Wahlkreises natürlich mehr tun, als sein unterlegener Gegner.
1910 erhielten dann die Gottscheer gewissermaßen die Quittung für das 19. Jahrhundert, das Ergebnis der letzten und damit authentischen Volkszählung in der österreichisch-ungarischen Monarchie: Nur noch 17.350 Menschen bekannten sich im Gottscheerland zur deutschen Muttersprache (Grothe, Seite 80). Die Differenz von rund 8600 auf die geschätzte Bevölkerung des Jahres 1875 (25.000-26.000) gibt nicht einmal den wirklichen Wanderungsverlust wieder, er ist tatsächlich wesentlich höher. Seit der Mitte der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren ja 35 Jahrgänge zur Welt gekommen. Davon waren die ersten sieben noch in voller Stärke geboren worden, weil in der Regel keine Ehepaare, sondern nur ledige, aber heiratsfähige junge Leute fortzogen. Sie heirateten erst in den USA. In der Bevölkerungsbilanz des "Ländchens" fehlten daher nicht nur sie selbst, sondern auch ihre "drüben" geborenen Nachkommen. Daheim wurde Jahrgang für Jahrgang schwächer. Trotzdem gab es noch einen, wenn auch bescheidenen. Geburtenzuwachs. Setzen wir ihn vorsichtigerweise für die Zeit von 1875 bis 1910 mit rund 3500 Köpfen an.
Diese Zahl überdeckt den Verlust durch die Auswanderer, sie muß daher den rechnerisch ermittelten 8600 zugezählt werden. Dadurch erhöht sich der wirkliche Bevölkerungsverlust auf 12.000 bis 12.500 Seelen. Soweit die nüchternen Zahlen, in denen auch die Angehörigen von Intelligenzberufen, die außerhalb der engeren Heimat ein Unterkommen suchen mußten, und deren Zahl auch nicht annähernd angegeben werden kann, mit inbegriffen sind. Der Bedarf an Lehrern und Geistlichen war begrenzt, die Stadt Gottschee bot nur ganz wenigen Juristen, Ärzten und Beamten oder Unternehmern mit höherer Schulbildung berufliche Chancen. Auf dem Lande bestand für die aufgezählten Berufsgruppen kein Bedarf.
Die natürliche Bevölkerungsbewegung innerhalb der Gottscheer Bauern war durch den schweren Aderlaß seit den achtziger Jahren empfindlich gestört. Der kleine Volkskörper hatte so viel biologische Substanz abgegeben, daß es nicht nur nicht mehr möglich war, sondern auch nicht mehr nötig war, die ein Menschenalter zuvor erforderliche Kulturfläche weiterhin in vollem Umfange zu bewirtschaften. Die Folge war eine Vernachlässigung des Weidelandes und der höher gelegenen Wiesen, die wiederum das Absinken des Viehbestandes nach sich zog. Der Wald aber trieb unverzüglich sein niederes Fußvolk, Gestrüpp und Stauden, in das ihm überlassene Gelände vor.
 |
 |
 |
 |
| Erzherzog
Franz Ferdinand mit seiner
Frau
Sophie von Hohenberg kurz vor dem Attentat. |
Attentäter Gavrilo Princip wird abgeführt. | ||
Kulturell war die Sprachinsel Gottschee zu Beginn des 20. Jahrhunderts infolge des voll ausgebauten Schulwesens und der ausschließlichen Verwendung der deutschen Hochsprache in den Kirchen, im Umgang mit den Ämtern, im Geschäftsleben, in der Presse und im Buch bis hinein in die privateste Sphäre des Gebetbuches und des Tischgebets ein Bestandteil jenes Lebensraumes in Mitteleuropa geworden, in dem alles Schriftliche deutsch ausgedrückt wurde. Als alltägliche Umgangssprache hatten die Gottscheer jedoch ihren mittelalterlichen bairisch-österreichischen Dialekt behalten. Freilich war noch ein anderer Gedanke in die Dörfer des Siedlungsgebiets eingezogen, die Sorge um das Gottscheerland. Sie steigerte sich zur Befürchtung, als am 28. Juni 1914 der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand einem Attentat zum Opfer fiel. Mit dem Instinkt der gefährdeten Kreatur ahnten die Gottscheer das kommende Unheil, den Zerfall der Donaumonarchie unter der Zentrifugalkraft des west-südslawischen Nationalismus. Das Völkchen im Karst hatte, wie auf das Jahr genau ein halbes Jahrtausend vorher, seine Schutzmacht verloren .. .

Kaiser Franz Josef I.
Am 21. November 1916 starb "der alte Kaiser" Franz Josef I., in seinem 86. Lebens- und 68. Regierungsjahr, schon zu Lebzeiten eine legendäre Erscheinung, auch und besonders für die Gottscheer. Gottschee war dem Monarchen ein fester Begriff, vor allem durch den Fürsten Karl von Auersperg. Wiederholt hatte der Kaiser Bittgesuche aus der Sprachinsel mit Geldspenden aus seiner Privatschatulle beantwortet.
Ganz Wien trug in jenen trüben Novembertagen nicht nur die sterbliche Hülle des alten Kaisers zu Grabe, sondern auch die Staatsidee und die Tradition des Hauses Habsburg. Der Zusammenbruch ihres geschichtlich gewachsenen Nationalitätenstaates war nur noch eine Frage der Zeit. Franz Josefs Nachfolger, Kaiser Karl I. von Habsburg-Lothringen, hatte der vorandrängenden Katastrophe nichts entgegenzusetzen, auch Franz Ferdinand hätte sie nicht aufhalten können. Ende November, Anfang Dezember 1918 konstituierte sich das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) unter König Petar I. Karadjordjevic. Das frühere Kronland Krain wurde mit der Untersteiermark zu der neuen Provinz Slowenien zusammengelegt. Ihre Nachbarn waren im Westen Italien, im Norden die Republik Österreich und im Osten das verkleinerte Ungarn.

König Petar I. Karadjordjevic
Die Gottscheer waren zunächst ratlos. An einen Widerstand wie zu Zeiten Napoleons war nicht zu denken. Alles war plötzlich anders. Bis auf jene in russischer Kriegsgefangenschaft kehrten die Krieger bald heim. Zunächst zaghaft setzte eine Diskussion, wie der neuen Lage zu begegnen wäre, ein. Eines Tages war ein faszinierender Plan aufgetaucht. Es läßt sich nicht mehr rekonstruieren, wer als erster den Gedanken aussprach, aus dem Gottscheerland eine kleine Republik, ähnlich wie Andorra, zu machen und sie dem Protektorat der Vereinigten Staaten anzuvertrauen. Man erhoffte sich für diesen Vorschlag eine wirksame Unterstützung von selten der Amerika-Gottscheer. Vielleicht gelang es ihnen, einen Machtspruch des Präsidenten Wilson herbeizuführen. Wilson, damals der mächtigste Mann der Welt, hatte mit seinen 14 Punkten bei allen neu entstandenen Minderheiten Europas Hoffnungen auf das Selbstbestimmungsrecht ausgelöst. Eine Denkschrift mit allen wesentlichen Angaben über Land und Leute von Gottschee wurde erarbeitet und ein Flugblatt herausgegeben. Eine Delegation für eine Vorsprache bei der Pariser Friedenskonferenz wurde gebildet.
Der Plan schlug fehl, wie jener im 16. Jahrhundert, als die Gottscheer beschlossen, den Grafen von Blagay finanziell abzulösen und sich selbst zu verwalten. Die Gottscheer fanden allenthalben verschlossene Türen. Der Weg zur Beseitigung des Gottscheerlandes aber war nun frei.
Es ist nicht Aufgabe zu untersuchen, auf welchen geschichtlichen Wegen die slowenischen Romantiker des 19. und 20. Jahrhunderts im Rahmen ihrer Eigenbewertung zu der bei Dr. Pozar vorgefundenen Konfrontation gegenüber dem Deutschtum gekommen sind, die darin gipfelt, daß der Deutsche stets und überall der Unterdrücker war, der sich der Entwicklung des slowenischen Volkstums entgegenstellte. Der Habsburger Monarchie warf man darüber hinaus vor, daß sie slowenische Menschen unter politischem und wirtschaftlichem Druck germanisiert habe und verstieg sich zeitweilig unter Ableugnung der geschichtlichen Tatbestände zu der Behauptung, die Gottscheer seien germanisierte Slowenen. Der slowenischen Führungsschicht wurde es schon im 19. Jahrhundert unerträglich, daß sie, wollte sie sich politisch, kulturell und gesellschaftlich durchsetzen, deutsch sprechen mußte. Vom Panslawismus gelenkt, übertrug sie schließlich ihre Antipathie gegen alles, was deutsch war, auf das deutsche Wesen, auf die gesamte deutsche Kultur, wo immer sie auch in Erscheinung trat.
Wenn nun im folgenden Kapitel die staatlichen Maßnahmen zur Slawisierung der Gottscheer aufgezeigt werden, so geschieht dies nicht, um alte Wunden aufzureißen. Die Gottscheer haben sich mit dem Verlust ihrer alten Heimat politisch abgefunden. Die Aufzählung der Unterdrückungsmaßnahmen nach 1918 geschieht auch nicht, um beschwerdeführend vor die Geschichte hinzutreten: Sie sind jedoch ebenfalls Gottscheer Geschichte und werden ausgesprochen, weil sonst das Verhalten der Gottscheer in den dreißiger Jahren unverständlich bliebe. Schließlich ging seit dem Ende des Jahres 1918 eine Flut von Gesetzen des Staates, Verordnungen der Landesregierung, Verfügungen der Bezirkshauptmannschaft und der Sicherheitsorgane mit entsprechenden Strafandrohungen auf die wehrlosen Gottscheer nieder.
Zum slowenischen Führer hatte sich bereits bis 1918 Dr. Anton Korosec kraft seiner politischen Erfahrung als Volkstumskämpfer und Parlamentarier emporgearbeitet. Die Ironie des Schicksals: "Korosec" heißt zu deutsch "der Kärntner".
Noch bevor der eben gegründete Staat der Serben, Kroaten und Slowenen vollends zur Ruhe gekommen war, forderte ein Komitee in Laibach, das sich "Narodna vlada" nannte, etwa gleichbedeutend mit "nationale Regierung", die Schließung aller deutschen Schulen und die Beschlagnahme aller Schulvereinshäuser in Gottschee. Daraus war bereits die Hauptstoßrichtung gegen das Gottscheerland erkennbar. Im Gegensatz zu den eigenen Erfahrungen im Volkstumskampf verweigerte die slowenische Führung den Gottscheern die politische Selbstbestimmung, ja, sie gewährte ihnen nicht einmal die kulturelle Selbstverwaltung. Ihre Art der "Selbstbestimmung" sah so aus: Sie stellte den Deutschen in Slowenien frei, sich um die Staatsbürgerschaft Österreichs zu bewerben. Da jedoch nur die Intelligenz bezüglich des Wohnortes beweglich genug war, um nach Österreich wirklich umzuziehen, zielte dieser Lockruf in erster Linie auf die Gottscheer Lehrer und die Beamtenschaft. Schon im Laufe des Jahres 1919 wurde erkennbar, daß das "Ländchen" führungslos gemacht werden sollte, um dann nach dem Beispiel der Sprachinsel Zarz in Oberkrain innerhalb von zwei, drei Menschenaltern als deutsche Enklave verschwunden zu sein. Um bei diesem Vorhaben nicht durch internationale Bindungen von außen gestört zu werden, unterschrieb der SHS-Staat im Jahre 1919 zwar den Vertrag von St-Germain mit Österreich sowie jenen von Trianon mit Ungarn. In beiden Verträgen hat sich Jugoslawien zum Schütze seiner Minderheiten verpflichtet, diesen jedoch nicht in seine Verfassung eingebaut. Der Völkerbund hat ebenfalls den Minderheitenschutz in Jugoslawien garantiert, eingehalten wurde er nie.

Karl Renner, Kanzler der Republik Österreich, Saint Germain, 1919.
Außer dem deutschen Schulwesen sollten aber auch alle anderen tragenden Elemente des Gottscheertums zu Fall gebracht werden. Diese waren das Hochdeutsche als Verwaltungs- und Geschäftssprache, die Mundart als Umgangssprache der Landbevölkerung und unverwechselbare Trägerin der Gottscheer Traditionen. Zu brechen waren außerdem der Widerstandswille im Volkstumskampf und die wirtschaftliche Standfestigkeit. Die deutsche Schriftsprache ließ sich aus dem ländlichen Leben ohne Schwierigkeiten entfernen. Bei der familiengebundenen Mundart war das schwieriger, aber auch da fand man einen Weg. In seiner Dokumentation: "Warum sind die Gottscheer umgesiedelt?" stellt der in Villach lebende Rechtsanwalt Dr. Viktor Michitsch aus Göttenitz die wesentlichsten Maßnahmen zur Entvolkung der alten Sprachinsel zusammen:
Die erste einschneidende Maßnahme war die Absetzung der deutschen Landbürgermeister zum 31. Dezember 1918. Wenige Monate später wurde der Bezirkshauptmann Otto Merk vom Dienst suspendiert. Das Slowenische wurde an den Volksschulen als Pflichtfach eingeführt. Der Bezirksschulinspektor Mathias Primosch wurde seines Amtes, das seit 1891 bestand, enthoben. Mit dem Schuljahr 1919/20 begann die vollständige Slowenisierung des Gymnasiums. Deutsch war nicht einmal mehr als Wahlfach zugelassen. Das dem Gymnasium angegliederte Studentenheim wurde entschädigungslos beschlagnahmt und einem slowenischen Verein übereignet. Das Waisenhaus mit der Mädchen-Bürgerschule wurde unter slowenische Leitung gestellt, der deutsche Schulunterricht verboten. Die Fachschule für Holzbearbeitung wurde geschlossen. Die beiden deutschen Kindergärten in der Stadt mußten ihre Tätigkeit einstellen. Der Gottscheer Lehrerverein wurde nach 41 jährigem Bestehen verboten, sein Vermögen eingezogen, seine Korrespondenz beschlagnahmt.
Parallel zur Zurückdrängung des deutschen Schulunterrichts wurde die Zahl der Lehrer dezimiert. Von den 71 im Jahre 1918 unterrichtenden deutschen Lehrpersonen wurden von 1919 bis 1922 nicht weniger als 33 über das zweifelhafte Optionsverfahren für Österreich aus dem Lande gedrängt. Sie hatten keine Möglichkeit zu bleiben, auch nicht, außerhalb ihres Berufs. Unter ihnen befanden sich geistig führende Männer, wie der Gymnasialprofessor Peter Jonke und sein Kollege Josef Obergföll, der bedeutende Volkstumsforscher Wilhelm Tschinkel, Bezirksschulinspektor Mathias Primosch u. a. ältere Lehrer, die des Slowenischen nicht mächtig waren, wurden vorzeitig pensioniert.

Josef Perz and Wilhelm Tschinkel
Die Dezimierung der bäuerlichen Bevölkerung der Sprachinsel wurde in Etappen durchgeführt. Nach der weitgehenden Entfernung der Lehrer wurde das Slowenische als Unterrichtssprache eingeführt. Gleichzeitig wurden die "deutschen Abteilungen" erfunden. 1926 gab es davon nur 16. Von einem zusammenhängenden deutschen Unterricht war dabei keine Rede mehr, weil bestimmte Fächer nur in slowenischer Sprache unterrichtet werden durften und weil kaum noch Lehrer, die den deutschen Restunterricht hätten erteilen können, zur Verfügung standen. - Die nächste Stufe waren die sogenannte Grundschule und die "National-Schule". Die letztere umfaßte die 5. bis 8. Klasse. Der Besuch der "National-Schule" wurde auch für die Schüler der deutschen Abteilungen verbindlich.
Die nächste Stufe: Um die Zahl der deutschen Schüler weiter zurückzudrängen, führte die Schulverwaltung eine "Namensanalyse" ein. Kinder, deren Familiengeschichte auch nur einen einzigen Großelternteil mit einem slowenisch klingenden oder slowenischen Namen aufwies, wurden in die slowenische Volksschule eingereiht. Auf Wünsche der Eltern wurde keine Rücksicht genommen. Dazu berichtet Dr. Michitsch ein eindrucksvolles Beispiel: Bereits 1922 ging die Schulleitung in Stockendorf dazu über, die dortige Volksschule vollständig zu slowenisieren. Sie behauptete, zum Schulbeginn würden 22 slowenische und nur 10 deutsche Schulpflichtige erscheinen. Die Nachprüfung dieser Angabe durch Gottscheer Eltern ergab, daß die Schule von 46 deutschen und nur von 6 slowenischen Kindern besucht wurde. Bei den letzteren sprachen drei mit Vater und Mutter slowenisch und drei nur mit der Mutter.
| Gottscheer Lehrerschaft, 1905 | Gottscheer Lehrerschaft, 1930 |
Dem flüchtigen Betrachter mögen die angeführten Schikanen als eine leichtfertige Ausdeutung guter slowenischer Absichten erscheinen. Wiederum drängt sich der Vergleich mit Kärnten auf. Dort verlangte man für die eigene Minderheit Kulturautonomie, und mehr, die Gottscheer aber wurden gleichzeitig im Eiltempo slawisiert. Man bediente sich dabei raffinierter psychologischer Mittel: Man drängte zwischen Mutter und Kind, die innigste Bindung zwischen Individuen, eine Sprache, die die Mutter nicht verstand und zwang gleichzeitig das Kind, diese Sprache zu erlernen und anzuwenden. Der Lehrer aber sah seine Hauptaufgabe nicht darin, dem Gottscheer Kind Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, sondern ihm alles Deutsche, ja sogar das Denken in der Mundart, auszutreiben. Schließlich verbot man den Kindern, auf dem Schulweg gottscheerisch zu sprechen. Gleich einem dichtmaschigen Netz lag die slowenische Schulpolitik über dem "Ländchen". Es gab kein Entrinnen. Blieb man im Lande, und das war die Regel, mußte man slowenisch lernen. 1924 wurde auch die letzte deutsche Ausbildungsmöglichkeit so gut wie unterbunden. 1919/20 war es üblich geworden, daß vielleicht zwei bis drei Dutzend schulentlassene Lehrer- und Bürgerkinder bzw. Gymnasiasten, ihre Ausbildung an Gymnasien, Lehrerbildungsanstalten, Handelsakademien, Staatsrealschulen und anderen Fachschulen in Österreich, namentlich in Kärnten, fortsetzten oder vollendeten. Einige wenige nahmen ihre Studien an Universitäten auf. 1924 erhielten die Eltern dieser Schüler und Studenten die amtliche Mitteilung, daß sie von 1925 an nicht mehr mit Reisepässen für die Ausbildung ihrer Kinder im Ausland rechnen dürften.
Die Auswirkungen dieser Schulpolitik auf die Gottscheer Jugend zeigte sich - in der ganzen Breite sichtbar - bereits nach einem Jahrzehnt. Die Buben und Mädchen waren bei ihrem Schulabgang sozusagen zweieinhalbsprachig. Als Mutter- und Haussprache verwendeten sie die Mundart, konnten leidlich slowenisch lesen und schreiben, waren aber des Deutschen nur sehr mangelhaft mächtig. Mit der Gottscheer Mundart konnten sie außerhalb der Sprachinsel nichts anfangen, ihr Deutsch war so schlecht, daß sie im Normalfall kaum einen Brief schreiben konnten, blieb also das Slowenische, wollte man außerhalb des bäuerlichen Wirtschaftssektors eine berufliche Laufbahn anstreben. Diese jungen Menschen standen gleichsam im Niemandsland zwischen den beiden Völkern. Da ihnen aber das Deutsche dennoch näher lag, die Wirtschaftslage sich zunehmend verschlechterte, reifte auch bei ihnen der Entschluß zur Auswanderung, die in bescheidenem Umfange 1920 wieder eingesetzt hatte. Dazu bekam man allerdings mühelos einen Reisepaß.
So wie der Jugend der Zugang zum Deutschtum und seiner Schriftsprache verbaut wurde, so tat die Landesregierung in Laibach alles, um den erwachsenen Gottscheern die Organisationsformen, die das Gemeinschaftsgefühl stärkten, und in denen hochdeutsch die offizielle Sprache war, wegzunehmen oder zumindest zu verleiden. Zuerst wurde der Bauernbund aufgelöst und die beiden politischen Parteien des "Ländchens" aus dem Vereinsregister gestrichen. Von den drei oben genannten Blättern überlebte nur der 1903 gegründete "Gottscheer Bote". Er durfte, ab 1919 in "Gottscheer Zeitung" umbenannt, weitergeführt werden. Selbstverständlich verschwanden sogleich nach der Gründung des neuen Staates die Schulvereinsortsgruppen. Die zu einem eigenen Gau zusammengeschlossenen freiwilligen Feuerwehren mußten die slowenische Kommandosprache einführen. 1925 durfte der verbotene Gesangsverein, ein gemischter Chor, wiedergegründet werden. Da er sich aber rasch zu einem neuen Kulturzentrum entwickelte, suchte man abermals nach einem Verbotsgrund. Man fand ihn in einer politisch harmlosen Sängerreise nach Kärnten.
17 Vereinsmitglieder, Frauen und Männer, besuchten am 5./6. Juni 1926 den von allen hoch verehrten Volkstumsforscher Wilhelm Tschinkel, um ihm zu seinem 50. Geburtstag die Grüße und Glückwünsche der alten Heimat zu überbringen. Der Gefeierte hatte in Rosegg eine neue Heimat gefunden. Nach ihrer Heimkehr wurde die Sängergruppe wegen Hochverrats angezeigt. Wahrheitswidrige Begründung: Die Sänger hätten in Kärnten an einem nationalen Sängerfest teilgenommen. Hier kann man nur noch von National-Hysterie sprechen. Zu einer Gerichtsverhandlung kam es jedoch nicht, weil ein einsichtiger Richter am zuständigen Amtsgericht in Rudolfswert (Novo mesto) das Verfahren wegen Nichtigkeit niederschlug. Die örtliche Sicherheitsbehörde in Gottschee/Stadt gab sich jedoch lieber der Lächerlichkeit preis, als einen deutschen Vogelschutzverein zu dulden. Ein Jahr nach der Gründung wurde er unter dem Vorwand verboten, daß die im Freien aufgestellten Futterkästen die Aufschrift "Vogelschutzverein" trugen. Dieselbe Behörde machte auch vor dem deutschen Leseverein nicht halt, er wurde verboten, seine 2500 Bücher beschlagnahmt und vernichtet.
Die Amtssprache bei den Behörden war selbstverständlich längst das Slowenische. Wer diese Sprache nicht beherrschte, mußte auf eigene Kosten einen Dolmetscher mitbringen. Die Ortstafeln durften nach einer kurzen Übergangszeit auch in den rein deutschen Dörfern nur slowenische Aufschrift tragen. Die oft willkürlich ins Slowenische übersetzten Ortsnamen der Gottscheer durften in der Gottscheer Zeitung nicht mehr deutsch gedruckt werden. Das 14tägig erscheinende Blatt war im übrigen einer scharfen Zensur unterworfen, das heißt, die fertig umbrochenen Seiten mußten der Bezirkshauptmannschaft vor dem Druck vorgelegt werden. Anfänglich nahm die Redaktion die gestrichenen Artikel und Notizen einfach heraus und ließ die weißen Flächen offen. Dadurch war die Zensur für jedermann sichtbar. Um dies zu verhindern, erhielt die Redaktion den Auftrag, für gestrichene Artikel Stehsatz bereitzuhalten.
In aller Stille wurde die Ablösung der Geistlichkeit vollzogen. An sich ließ das Ordinariat in Laibach die noch amtierenden Gottscheer Geistlichen gewähren. Es versetzte auch keinen Geistlichen in rein slowenisches Gebiet, wie die Schulbehörde dies mit einigen Lehrern tat. Wenn jedoch ein Mitglied des Gottscheer Klerus durch Tod oder Pensionierung ausfiel, trat an seine Stelle ein nationalbewußter Slowene im Priesterrock.
Verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit widmete man anfänglich dem Bodenbesitz im "Ländchen", obwohl der slowenische Anteil äußerst gering war. Herbert Otterstädt nennt in seinem Bildband auf Seite 37 dazu folgende Zahlen: "Im Jahre 1940 waren nach einer sehr gewissenhaften privaten Besitzzählung von den insgesamt 840 Quadratkilometern der Volksinsel 547 Quadratkilometer in den Händen der Gottscheer Waldbauern, 63 Quadratkilometer waren Gottscheer Gemeindebesitz, 176 Quadratkilometer enteigneter deutscher Waldbesitz und lediglich 53 Quadratkilometer, also keine 8 der Gesamtfläche, waren slowenischer Zwergbauernbesitz".
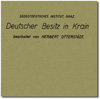
Deutscher Besitz in Krain, Herbert Otterstädt, nationalsozialistisches Südostdeutsches Institut Graz, 1940.
Der einzelne Gottscheer Bauernhof interessierte die slowenische Führung noch in den zwanziger Jahren kaum. Erheblich störte es sie jedoch, daß der aller Titel entkleidete Fürst Auersperg bei der Staatsgründung noch 229 Quadratkilometer herrlichen Mischwaldes besaß und nach modernen forstwirtschaftlichen Methoden nutzte. Die Beschlagnahme dieses Rests der ursprünglichen Herrschaft Ortenburg begann 1921 mit einer schlichten "Agrarverordnung". Zehn Jahre später wurde diese zum Gesetz ausgestattet und damit endgültig gemacht. 176 Quadratkilometer wurden damals der Familie Auersperg genommen. Der konfiszierte Waldbesitz wurde jedoch nicht etwa den Gottscheern zugeteilt, die als uralt eingesessene Bewohner des Gottscheerlandes wohl als erste Anspruch hätten erheben können. Die Nutzung des Baumbestandes wurde vielmehr slowenischen Dörfern außerhalb der Sprachinsel überlassen. Die Gottscheer Mitarbeiter der Auerspergschen Forstverwaltung wurden entlassen.
Wie wenig die abseits liegenden neuen Nutzungsberechtigten bzw. die Landesforstbehörde mit den beschlagnahmten Wäldern anfingen, bewies unter anderem der Verfall des größten Auerspergischen Sägewerks samt den Arbeiterwohnhäusern im Revier Hornwald. Was der vordringende Urwald sowie Wind und Wetter übriggelassen hatten, wurde 1938 gesprengt. Nicht einmal die 50 Kilometer lange Waldschmalspurbahn durfte bestehen bleiben. Sie wurde im gleichen Jahr verschrottet.
 |
 |
 |
 |
|
| Auerspergsche Sägewerk, 1931 |
1943 | Merkantilna Banka / Merkantil Bank, 1925 | ||
Der Gottscheer Landwirtschaft rückte man als Ganzes dergestalt zu Leibe, daß man alles beseitigte, was geeignet war, sie zu fördern und zu befruchten. So wurde gleich nach dem Kriege die aus der Zeit Kaiser Joseph II. stammende Filiale der "landwirtschaftlichen Gesellschaft von Krain" verboten, der Bauernbund eingestellt, 12 ländliche Raiffeisenkassen erlitten dasselbe Schicksal. Die Stadtsparkasse wurde finanziell ruiniert, und die Einleger verloren ihr Geld. Sie sollten auf diese Weise gezwungen werden, mit der Filiale der Laibacher "Merkantil Bank" zusammenzuarbeiten. Auf Anordnung ihres Chefs durfte in den Geschäftsräumen nur slowenisch gesprochen werden.
Die Geschäftsleute und Handwerker in Stadt und Land, aber auch die Bauern, ruhten nicht eher, bis sie wieder über ein eigenes Geldinstitut verfügten: 1926 wurde die "Spar- und Darlehenskasse", eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung, ins Leben gerufen. Zum Obmann wählten die Mitglieder den Mitbegründer Alois Kresse, angesehener Kaufmann in Gottschee/Stadt. Kresse besaß große wirtschaftliche Erfahrung und war im ganzen "Ländchen" bekannt. Von 1912 bis 1925 war er Obmann des Gottscheer Handelsgremiums. Von 1928 bis 1930 war er als Vizebürgermeister Obmann der Städtischen Vermögensverwaltung. Nach 1930 durften die Bewohner des Städtchens keine Vertreter mehr in den Stadtrat entsenden. 1945 gelang es Alois Kresse nicht mehr, rechtzeitig aus der Untersteiermark, wo er sich in Cilli eine neue Existenz geschaffen hatte, zu fliehen. Er wurde mit seiner Gattin von Partisanen umgebracht.
All diese kulturellen und wirtschaftlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Sprachinsel Gottschee zeigten in den ersten dreißiger Jahren die beabsichtigte Wirkung - nicht bei den vor 1914 geborenen Jahrgängen, wohl aber bei den im Jahre 1933 etwa Sieben- bis Siebzehnjährigen. Slowenische Worte mischten sich in den heimatlichen Dialekt, slowenische Lieder klangen da und dort außerhalb der Schule auf, die eigenen Mundartlieder traten noch stärker in den Hintergrund. Das Fundament des nationalen Selbstverständnisses als Deutsche stand bei diesen jungen Leuten nicht mehr auf sicherem Boden.
Gleichgeblieben war indessen das Interesse von Wissenschaftlern für die Sprachinsel Gottschee. Namentlich aus Österreich, immer öfter aber aus dem Deutschen Reich, erschienen um die Wende der zwanziger zu den dreißiger Jahren Sprachforscher, Historiker, Volkskundler, Volskliedforscher sowie landschaftsbegeisterte Touristen, einzeln und in Gruppen. Die Besucher fanden in den abgelegenen Dörfern im großen und ganzen noch das urwüchsige Gottscheer Bauernleben, wie es Sepp König in seinem Beitrag: "Das Dorf in der Einschicht" (Gottscheer Zeitung, März 1973) etwa für die Zeit der Jahrhundertwende schildert:
"Jedes Dorf hatte seine Eigentümlichkeiten in seiner schaffenden Arbeit. Die Menschen in der Einschicht waren daher Alleskönner: Korbflechter, Schaufelmacher, Faßbinder und Schnapsbrenner, sie besorgten Zimmermannsarbeiten ebenso mit Geschick wie bäuerliche Verrichtungen. Ihre Geschicklichkeit reichte über die bescheidene Heimat hinaus und war als nachbarliche Hilfe bei einem Unglück im Stall geschätzt. Der Bau eines Kalkofens war ihnen nicht unbekannt, und daß das Weib in der Einschicht im Krankheitsfalle Hilfe zu geben wußte, war keine Seltenheit."
Den Besuchern aus dem geschlossenen, deutschen Lebensraum entging allerdings auch nicht der wirtschaftliche Zusammenbruch der Gottscheer und ihre Mutlosigkeit. Helfen konnten sie ihnen nicht. - Unter den Gästen aus dem Deutschen Reich befand sich der Leipziger Orientologe und Volkstumsexperte Prof. Dr. jur. et. phil. Hugo Grothe. Seine wiederholten Aufenthalte im "Ländchen" führten in der Monografie "Die deutsche Sprachinsel Gottschee in Slowenien" zu einem freudig begrüßten Erfolg, waren doch seit dem Erscheinen des letzten repräsentativen Werks über das Gottscheerland (Hauffen 1895) immerhin 35 Jahre verstrichen. Man sagte ihm nach, er habe der damaligen Gottscheer Führung geraten, mit einer weithin wirkenden 600-Jahr-Feier der deutschen Kolonisation ihres Siedlungsgebiets die breite Öffentlichkeit auf die aktuelle, nationale Bedrängnis und die schier ausweglose wirtschaftliche Notlage der Gottscheer zu lenken. Mit diesem Ereignis sollte ihr Selbstbewußtsein gestärkt, neuer Lebensmut geweckt werden.
Der Grothesche Gedanke wurde mit Freuden und sofort aufgegriffen. 1929 bildete sich unter dem Vorsitz des Rechtsanwaltes Dr. Hans Arko ein Festausschuß, der die 600-Jahr-Feier auf den 1. bis 4. August 1930 festsetzte. Dr. Arko, ein vielseitig begabter Mann, war in den zwanziger Jahren in die Rolle des Sprechers der Gottscheer hineingewachsen. Unter anderem dirigierte er den gemischten Chor und führte als Gauhauptmann die Feuerwehr. Seit 1917 unterhielt er in der Stadt eine Rechtsanwaltskanzlei.

Dr. Hans Arko, Gottscheer Sängerschaft, 1928
Die organisatorisch wohl vorbereitete 600-Jahr-Feier wurde zum größten Fest, das die Gottscheer jemals auf ihrem Heimatboden veranstalteten.
Seit dem Bestehen des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen, das sich nunmehr als "Jugoslawien" bezeichnete, hatten die Gottscheer keinen Zweifel über ihre - von der Vernunft diktierte - loyale Einstellung zum Staat, aber auch ihre innere Bindung an ihr Volk gelassen. Konsequent und mutig lud der Festausschuß daher den König, damals Alexander I., die Staatsregierung in Belgrad, die Landesregierung in Laibach, künftig "Banschaftsverwaltung" genannt, mit dem "Banus" an der Spitze, sowie die Republik Österreich und das Deutsche Reich offiziell ein. Der König entsandte einen Minister und hohe Militärs als seine Vertreter. Von der Banschaftsverwaltung in Laibach erschien der Banus, das Deutsche Reich und die Republik Österreich ließen sich durch ihre Missionschefs bei der jugoslawischen Regierung vertreten. Deutscher Gesandter in Belgrad war dazumal Ulrich von Hassel. Erschienen waren unter anderem auch die beiden Spitzenpolitiker der deutschen Gesamtvolksgruppe in Jugoslawien, der Abgeordnete in der Skupstina, Dr. Stefan Kraft, und der Senator Dr. Georg Graßl, ferner der Präsident des "Schwäbisch-deutschen Kulturbundes" in Neusatz, Johann Keks, und der Hauptschriftleiter des "Deutschen Volksblattes", ebenfalls in Neusatz, ein gebürtiger Gottscheer aus Mitterndorf, Dr. Franz Perz. Viele Gottscheer in Österreich und in den USA benutzten das große Fest zu einem Besuch der alten Heimat.
Erster Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Nur ein Bruchteil der riesigen Menschenmasse fand im Dekanatsgotteshaus Platz. Selbst tiefergriffen, hielt der geistliche Rat August Schauer, Nesseltal, eine politisch wie menschlich und historisch ausgewogene Predigt von imponierender Sprachgewalt. - Die hohen Gäste vereinigte ein offizielles Bankett, auf dem Ulrich von Hassel diplomatisch geschickt und geistvoll die Beziehung zwischen dem Stadtwappen der Stadt Gottschee aus dem Jahre 1471 und dem aktuellen Anlaß herstellte. - Der öffentliche Festakt zur Erinnerung an die Besiedlung des Gottscheerlandes vor 600 Jahren fand in einem Großzelt statt, das an der Allee für diesen Zweck aufgestellt worden war. - Durch ein staunendes, glückseliges Spalier ritt und fuhr und schritt der selbst Geschichte gewordene historische Festzug von einem Ende der Stadt zum anderen. Es schien, als ob außer den Ältesten und den Jüngsten kein Gottscheer daheimgeblieben war, um sein Bekenntnis zu den sechs Jahrhunderten der Geschichte des "Ländchens" abzulegen. - Ein Festbuch mit Beiträgen zur Vergangenheit, Landes- und Volkskunde des Gottscheerlandes war Bestandteil der bewegten Woche. -

Gottschee 600-Jahr-Feier, 1.-4. August 1930
Presse, Rundfunk und Wochenschauen berichteten über die festlichen Tage von Gottschee. Der politische Erfolg blieb jedoch aus. Die Hochstimmung der Gottscheer klang wieder ab. Nur allzubald stellte sich der Alltag des Volkstumskampfes und der zermürbenden, wirtschaftlichen Erfolglosigkeit wieder ein. Nichts hatte es den Gottscheern genützt, ihre Staatstreue in den Vordergrund zu stellen. 1931 wurde beispielsweise das Minderheitenschulwesen in Jugoslawien "neu geordnet". Es richtete sich vor allem gegen die deutsche Minderheit und verfügte, daß in Orten, in denen "Staatsbürger mit anderer Muttersprache" lebten, Schulabteilungen mit 30, in Ausnahmefällen 25 Schulkindern errichtet werden durften. Die Entscheidung darüber behielt sich der Unterrichtsminister vor. Woher der Schuß kam, ließ sich leicht daran ermitteln, daß der Innenminister in der damaligen Regierung Dr. Milan Stojadinovic Dr. Anton Korocec hieß. Als Kabinettsmitglied hatte er keine Schwierigkeit, seinen Kollegen, den Unterrichtsminister, zu diesem Erlaß zu bewegen. Er traf die Gottscheer doppelt hart. Die "deutschen Abteilungen" waren nun zahlenmäßig nach oben begrenzt. In den größeren Dörfern war es trotz der Namensanalyse noch möglich, 30 Kinder für eine deutsche Abteilung aufzubringen. Die kleineren Schulsprengel aber brachten als Folge der Auswanderung und der Namensanalyse vielfach nicht einmal die 25 Schulkinder auf.
 |
 |
| König Peter II. v. Jugoslawien - | in Sokoluniform und Ministerpräsident Dr. Stojadinovic, Mai 1937 |
Zu der entmutigenden und entwürdigenden nationalen Unterdrückung kommt die fortschreitende wirtschaftliche Not. Die Weltwirtschaftskrise von 1929/30 trug direkt und indirekt wesentlich dazu bei. Nicht nur sanken die ohnehin geringer gewordenen eigenen Umsätze weiter, sondern auch der Dollarsegen ebbte ab. - Der Wald ergriff vom weiteren Kulturland Besitz. Der Viehbestand sank katastrophal. Selbst die stark zurückgegangene Milchproduktion war nicht mehr verwertbar. Die Milch wurde an die Schweine verfüttert. Die Obsternten blieben liegen. Der Holzhandel stockte. Nur noch wenige Männer gingen hausieren. Kleinhöfe und Keuschler unterschritten vielfach das Existenzminimum.
Der kleinste, deutsche Stamm, wie sich die Gottscheer gerne nannten, fand sich nicht mehr im Gleichgewicht. Manche Anzeichen schienen darauf hinzuweisen, daß er sich selbst aufzugeben begann. Einer der damals Jungen, Richard Lackner aus der Stadt, hat das bitterste Wort jener Tage nicht vergessen: "Hier zahlt sichs nicht mehr aus!"
Dr. Josef Krauland erinnert sich in seinem Beitrag "Ein Arzt erzählt..." (Gottscheer Zeitung, August 1970) noch gut an ein Gespräch mit einem Gottscheer Bauern über die Auswanderung: "Ich befand mich auf der Rückfahrt von Ebental. Mein Kutscher, ein intelligenter Bauer, mit dem man sich über alles Mögliche unterhalten konnte. Endlich kamen wir auf seine Familienverhältnisse und seinen Besitz zu sprechen. Auf meine Frage, welches von seinen Kindern einmal den Hof übernehmen werde, antwortete er: Keines, alle wollen nach Amerika, und ich will es ihnen nicht verwehren. Als ich dagegen einwandte, daß doch wenigstens eines in der Heimat bleiben sollte, meinte er: Ich kann es von keinem verlangen. Sie sehen doch selbst, wie man sich hier auf einem Bauernhof abrackern muß und dabei kann man nicht einmal die Substanz erhalten. Wenn die Kinder in Amerika fleißig sind und etwas Glück haben, bringen sie es in einigen Jahren weiter als hier ihr ganzes Leben."
Die Gottscheerin hat es verlernt, zu singen und zu fabulieren. Die Lebensschule, in der sie die Lehrerin ihrer Kinder und in der die Unterrichtssprache das Gottscheerische war, entgleitet ihr ...
30. Januar 1933, Berlin. Hitler ist an der Macht.
Wie alle deutschen Volksgruppen in Südosteuropa und in der deutsch-slawischen Mischzone zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer blickten auch die Gottscheer nach Berlin. Wer will ihnen dies angesichts der geschilderten Lebensumstände verdenken?! Sie blieben ruhig, wurden jedoch von den jugoslawischen Sicherheitsorganen noch mißtrauischer beobachtet als zuvor. Nicht minder mißtrauisch - aufmerksam registrierte die slowenische Führung alle Vorgänge in der Reichshauptstadt. Die Machtergreifung Hitlers löste bei ihr etwa folgenden Gedankengang aus: Hitler war Altösterreicher. Sein politischer Werdegang wies ihn als extremen Nationalisten aus. Zu seinen obersten erklärten Zielen gehörte der Anschluß der Republik Österreich an das Deutsche Reich. Krain war jahrhundertelang ein Kronland der Habsburger gewesen. Konnte man sicher sein, daß er beim "Anschluß" nicht auch ganz Slowenien dem Reich einverleibte? Wer konnte ein hochgerüstetes Deutschland daran hindern, darüber hinaus in den Donauraum - oder und - an die Adria vorzustoßen? In beiden Fällen bot sich Gottschee als machtpolitischer Brückenpfeiler an. Schon aus diesen Gründen mußte Gottschee nun erst recht verschwinden .. .
Dieses völkische Eiland aber wollte weiterleben, aus eigener Kraft, nur für sich selbst, ohne Machtanspruch, ohne politische Ambitionen. Die Slowenen standen dem in ihrem Nationalstolz entgegen. Sie bedachten allerdings dabei nicht, daß es bereits im 6. Jahrhundert nach Christi eine Art italienische Ostpolitik gab, dargestellt durch die Patriarchen von Aquileja und später durch die Republik Venedig. In Rom erinnerten sich die Nationalisten indessen seit längerer Zeit der Tatsache, daß der Patriarch von Aquileja die Mark Krain viele Jahrhunderte lang zu seiner Kirchenprovinz zählte und von 1077 an bis 1420 ausgedehnte Reichslehenschaften besaß.
Das Völkchen im Karst aber geriet wiederum, diesmal endgültig, zwischen die Mühlsteine der "großen Politik". Mit dem Urwald wäre es durch Modernisierung der Land- und Forstwirtschaft fertiggeworden, auch dem Wassermangel wäre durch noch sorgsamere Pflege und Nutzung der natürlichen Bestände beizukommen gewesen. Vielleicht hätten sich die Bauern unter dem Druck der Wirtschaftslage zu einer Neuordnung der Bodenverfassung, einer Flurbereinigung bewegen lassen. Das alles hätte dazu beigetragen, das "Ländchen" attraktiver zu gestalten. Gegen die Diktaturen in Berlin, Rom und Laibach wuchs im Gottscheerland jedoch kein Kraut.
("Jahrhundertbuch der Gottscheer", Dr. Erich Petschauer, 1980)
www.gottschee.de

